Mit Straumēni von Edvarts Virza veröffentlicht der Guggolz Verlag Berthold Forssmans deutsche Übersetzung eines lettischen Klassikers aus dem Jahr 1933, der den Alltag auf einem ländlichen Gutshof im Verlauf eines Jahres nachzeichnet. Wer sich auf die Ruhe des vormodernen Landlebens einlässt, den erwarten nicht nur leise Töne.
von Christiane Schäfer
Den Inhalt von Edvarts Virzas ‚Prosapoem‘ zusammenfassen zu wollen fühlt sich seltsam und beinah geschwätzig an. Eine herkömmliche Handlung sucht man vergebens. Stattdessen begleiten Leserinnen und Leser das Gut Straumēni irgendwo im lettischen Zemgale durch die Jahreszeiten. Wir erfahren vom Frühlingshochwasser, der Aussaat, der Feier der Johannisnacht, der Heuernte, dem Einmachen der Früchte im Herbst, dem Holzfällen für den Winter.
Straumēns, der Gutsherr und seine Frau, ihr Sohn, die Knechte und Mägde, junge Bauern und alte Nachbarn treten auf, aber sie stehen zurück hinter den wirklichen Hauptpersonen: dem Hof, dem Land, der gleichbleibenden Arbeit und der Wiederkehr der Jahreszeiten und Arbeitsschritte.
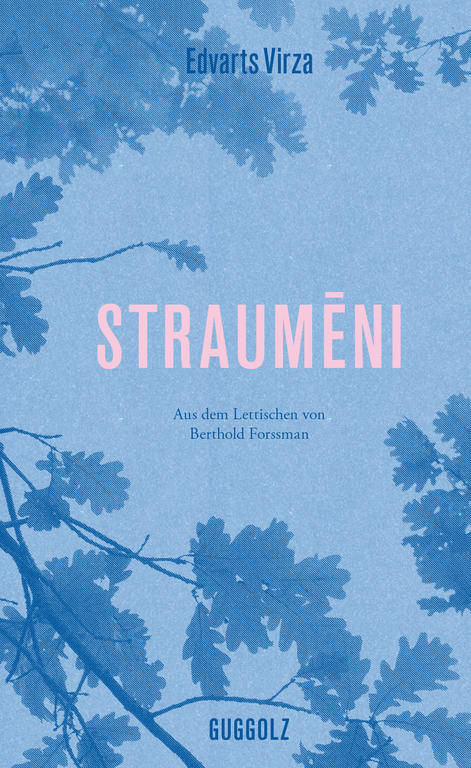
Dementsprechend gibt es im Text wenig bis gar keinen Dialog. Die Bewohner*innen von Straumēni verstehen sich auch ohne Worte. Und überhaupt: Beim Schuften wird nicht geredet. So wie die Natur mit ihren Jahreszeiten die Arbeitsroutine prägt, prägt allgegenwärtige Arbeit die Menschen. Der Text nimmt sich Zeit für einzelne Tätigkeiten und Abläufe, die im Detail beschrieben werden, ohne dabei zu belehren. Wenn der Alltag auf dem Gutshof von der Stimme des Erzählers kommentiert wird, dann ist es eine mythische und mystische Bedeutungsebene, die sich erstaunlich vehement über die pragmatischen Schilderungen und stillleben-gleichen Momentaufnahmen legt: Die Hausherrin, die in der dunklen Küche den bebenden und lebenden Hefeteig knetet, formt, wachsen lässt und zur Vollendung bringt, wird zum Ausdruck einer weiblichen Schöpfungskraft. Der Gutshof fungiert als Gotteshaus, der Arbeit gewidmet. Die Kartoffelernte wird zum demütig knienden Gebet. Mit dem ersten Morgentau schreitet Māra über die Äcker und besucht die Schlafenden. Und wie ein Gegenstück zu Dante tritt der Dichter einen Gang durchs Totenreich an: Er muss nicht zu den Geistern der Vergangenheit hinab- oder hinaufsteigen, sondern wandert über die Weite des Landes und der Felder.
Ob bei der repetitiven Feldarbeit, dem schöpferischen Brotbacken oder beim ausgelassenen Feiern der großen Feste, es zieht sich eine Mystik, eine Verbindung zur alles umgebenden Größe durch den Text, die sich aber selbst ganz nüchtern nimmt, nicht erklären will und keine Erklärung zu brauchen scheint.
In der vom Autor selbst gewählten Bezeichnung ‚Prosapoem‘ schwingt bereits neoklassische Erhabenheit mit, die Abkehr vom Partikulären der modernen Romanform.
Passend dazu wird Straumēni in der Rezeption gelegentlich auch als ‚lettische Bibel‘ bezeichnet, ein Vergleich, der zunächst irritiert, wenn man sich beim Lesen in den mäandernden, aber nicht moralisierenden Naturbeschreibungen verliert. Aber spätestens im Sommer angekommen wird deutlich, dass Virza hier nicht die Geschichte der Familie Straumēnsschreibt (im Lettischen in der Pluralform Straumēniverwendet), sondern das Bild einer sinnerfüllten Erde zeichnet. Wie in einer vorbabylonischen Welt gibt es kein Missverständnis (und damit keinen Grund zu sprechen); bis in die kleinesten Geräusche und die repetitivste Handbewegung fügt alles sich in einander: „Sie dachten und glaubten gleich, und durch das ganze Volk ging derselbe Klang wie durch einen gut gehärteten Topf, wenn man mit der Hand dagegen schlägt.“
Virza beschreibt das lettische Landleben bereits aus der nostalgischen Retrospektive, aus der Distanz von fast fünfzig Jahren, einer Zeitspanne, innerhalb der sich auch das Leben auf Gutshöfen wie Straumēni unumkehrbar änderte. So wirkenseine Arbeitsszenen oder seine mäandernden Naturbeschreibungen wie in ein goldenes Licht getaucht, begleitet vom Schweigen der Menschen, aber erfüllt von einem stetigen ‚Summen, Rascheln, Knistern und Duften‘, wie es der Klappentext verspricht.
Übersetzer Berthold Forssman schafft es hervorragend, diesen schweigsamen Klang ins Deutsche zu übertragen. Darüber hinaus gibt er uns ein ausführliches Nachwort an die Hand, das in einige der unausgesprochenen oder der mit knapper Selbstsicherheit hingeworfenen Kernelemente des Texts einführt: In das Leben und die Bedeutung des Autors, der den meisten Leser*innen der deutschen Neuübersetzung unbekannt sein dürfte, aber zu den Größen des modernen lettischen Nationalkanons gehört. In den historischen Hintergrund eines Lettland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, mit selbstständigen Gutshöfen, mit erst vor einer Generation abgeschaffter Leibeigenschaft und einer beiläufigen Vermischung von christlichen und heidnischen Elementen, einem Nebeneinander von Jesus und Pērkons. Die starke Fokussierung auf Ästhetik kann man kritisch sehen oder für ein Anzeichen der Dekadenz der 1930er halten; den stellenweise aus dem Nebel tretende Volksbegriff diffus bis problematisch. Aber bei all dem bleibt Straumēni ein sehnsüchtiges Buch, vielleicht sogar ein wehmütiges.
Warum lohnt es sich, diesen Text heute noch einmal zu übersetzen und zu lesen? Mit dem wunderschön sanften, hellblauen Cover der Guggolz-Ausgabe scheint Straumēni zugeschnitten auf die Faszination moderner Leser*innen: Ein Versprechen von Entschleunigung, von Natur, aber ohne Krise, von Handarbeit, und ohne Entfremdung. Von einer Ruhe, in der man sich selbst kennen lernen kann. Vielleicht das perfekte Buch für Corona-Krise und Lockdown? Immerhin hat es Straumēni z.B. auf Platz 2 der #ZuhauseBleiben-Literaturliste der Plattform „Latvian Literature“ geschafft.
Dabei bewahrt es sich gleichzeitig genug Fremdheit, gerade in den mystischen Zügen, um nicht einfach in bloßer Wohlfühl-Lektüre, in einer eskapistischen Fetischisierung des Landlebens oder in einem Karussell introspektiver Selbstspiegelung aufzugehen.
Und wenn die stummen Bewohner*innen von Straumēni eins mit uns teilen, dann ist es ihr Blick nach außen, statt nach innen, und die Leichtigkeit, die damit einhergeht. Edvarts Virzas Straumēni richtet sich an Leser*innen, die nicht sich selbst suchen, sondern lauschen und beobachten. Für sie spricht, schreit, brüllt die ganze Erde:
„Es herrschte keine Stille. Im Nebel war das Fließen unsichtbaren Wassers zu hören, und überall plätscherte es. Es riefen verschiedene Sumpfvögel, die alle am selben Tag angeflogen gekommen waren und durch den dichten Nebel streiften. Am anderen Ufer der Lielupe ertönte das laute Brüllen eines Bachs, der plötzlich entfesselt worden war und jetzt in das lehmige Wasser des Flusses herabstürzte. Irgendwo in der Ferne klagten die Kiebitze[.] Es war windstill, aber warme Luftströme streiften vorbei, denn auch der Himmel war voller Unruhe.“
Edvarts Virza: Straunēni. Aus dem Lettischen von Berthold Forssman. Berlin: Guggolz Verlag, 2020. Erstveröffentlichung: Riga 1933
Klingt so, als sei auch dies wieder eine Meisterleistung des Guggolz-Verlages!
LikeLiked by 1 person